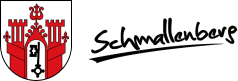Stadtgeschichte
Stadtgründung
Offiziell blickt die Stadt Schmallenberg auf eine fast 800 Jahre lange Geschichte zurück. Mit der Urkunde vom Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden wurden Schmallenberg 1244 offiziell die Stadtrechte verliehen. Schon im Jahre 1072 wurde das Kloster Grafschaft gegründet, in dessen Gründungsurkunde mehrere heutige Schmallenberger Orte zum ersten Mal namentlich genannt wurden.
- Waffenfunde auf dem Wilzenberg lassen auf eine Besiedlung in der Eisenzeit schließen. Außerdem weisen die dortigen Wälle auf eine Befestigung schon im Frühmittelalter hin.
- 1072 wurde das Benediktiner-Kloster Grafschaft durch Anno II. von Köln gegründet. Die ersten Mönche kamen dabei aus dessen vorheriger Klostergründung in Siegburg.
- Vermutlich nach 1180 wurde an der Stelle der heutigen Kapelle auf dem Werth eine kleine Burg (Smale Burg) zum Schutz des Klosters Grafschaft und der Heidenstraße, welche von Köln nach Kassel führte, errichtet.
- 1228 wurde ein Alexander de Smalenburg in einer Grafschafter Urkunde erwähnt.
- Wohl bis zum Jahre 1240 ist die Smale Burg allmählich zerfallen.
- 3. März 1244: Mit der Urkunde des Kölner Erzbischofes Konrad von Hochstaden erfolgt die Befestigung der Stadt sowie die Gewährung der Stadtrechte.
- Schmallenberg war zu diesem Zeitpunkt schon eine voll entwickelte Stadt. So führte sie ein eigenes Siegel und auch ein handelndes städtisches Gremium wird in der Urkunde von 1244 schon erwähnt.
- Durch die Befestigung mit einer Stadtmauer und drei Toren, stieg Schmallenberg offiziell im mittelalterlichen Sinne zu einer Stadt auf.
- Die Smale Burg wurde fortan nicht mehr benötigt und lag außerhalb der Stadtmauer brach.
- Mit der Vergabe der Stadtrechte, ging auch das Recht auf Münzprägung einher und so wurde Schmallenberg in der Folge zu einer der bedeutendsten kölnischen Münzprägestätten in Westfalen.
Frühe Neuzeit/Handel/Hanse
Im Laufe der Zeit wurde Schmallenberg zunehmend zu einer wichtigen Stadt im Fernhandel des Sauerlandes. Auch der Beitritt in die westfälische Hanse spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die kriegerischen Zeiten der Frühen Neuzeit verschonten auch Schmallenberg nicht, und so ist nach dem Spätmittelalter ein Rückgang in der Bedeutung der Stadt zu erkennen.
- Schon seit der Gründung war Schmallenberg ein entscheidender Standort für den Handel. Besonders durch die eigenen Münzprägestätte und die Nähe zum Kloster Grafschaft, konnte die Stadt wirtschaftlich profitierten.
- Ebenso begünstigte die Lage Schmallenbergs an der sogenannten Heidenstraße das aufblühen der Stadt. Diese führte von Köln nach Kassel, wobei Schmallenberg je eine Tagesreise von Attendorn und Medebach entfernt lag.
- 1274 ist ein Schmallenberger Hansekaufmann in London nachweisbar und 1312 im englischen Boston.
- Der Markplatz galt als wichtiges wirtschaftliches Zentrum der Stadt. Hier erfolgte der Handel mit lokalen Wollwaren.
- Zwischen den Jahren 1300 und 1500 ist ein leichter Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Während 1300 noch 120 Häuser in der Stadt nachweisbar sind, waren es 200 Jahre später nur noch 97 Häuser.
- Diese Abnahme der Bevölkerung, geht auch mit dem Verlust der wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt einher. Der Handel konzentrierte sich immer mehr in den wachsenden Städten.
- Dafür nahmen in der Zeit die Gerber- und Schmiedezünfte zu.
- Schon im Spätmittelalter wurden einige der umliegenden Dörfer verwüstet, u.a. durch die Soester Fehde. Andere Dörfer lagen mit der Zeit brach und wurden aufgegeben.
- In der Frühen Neuzeit litt die Stadt unter den Kriegen der Zeit. Im 17. Jahrhundert durch den 30-jährigen Krieg und später durch den 7-jährigen Krieg.
- Außerdem brannte Schmallenberg in der Zeit dreimal ab: 1608, 1732 und 1746.
- Erst mit dem aufkommenden Metallgewerbes ab dem 17. Jahrhundert blühte die Stadt langsam wieder auf.
Hessische und Preußische Zeit
Die kurkölnische Zeit in Schmallenberg dauerte von 1180 bis 1803. Danach gehörte die Stadt kurzzeitig zu Hessen-Darmstadt, bevor sie ab 1816 dem preußischen Herzogtum Westfalen angehörte.
- 1803 wurden durch den Reichsdeputationshauptschluss alle kirchlichen Besitzungen säkularisiert. Das kurkölnische Herzogtum Westfalen wurde dabei dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt zugesprochen.
- Ab 1816 gehörte das Herzogtum und damit auch Schmallenberg zu Preußen.
- Damit einhergehend wurden auch die Ämter Schmallenberg und Fredeburg gegründet, welche als Verwaltungsstrukturen bis zur Kommunalen Neugliederung bestand haben sollten.
Stadtbrand 1822
Am 31. Oktober 1822 brannte fast ganz Schmallenberg ab. Der Wiederaufbau erfolgte nach in Arnsberg entworfenen Plänen und gab der Kernstadt ihr heute noch markantes Bild.
- Am 31. Oktober 1822 zündete Johannes Kevecordes beim Decken seines Strohdaches eine Pfeife an, welche innerhalb kürzester Zeit einen Großbrand verursachte.
- 131 Häuser in Schmallenberg brannten nieder. Einzig die Häuser im Südosten der Stadt blieben verschont, darunter das sogenannte Schmale Haus.
- Der Wiederaufbau erfolgte nach dem Plan einer klassizistischen Bauvorstellung, welcher in Arnsberg entworfen wurden.
- Der neu entstandene historische Stadtkern auf dem Bergrücken oberhalb der Lenne gleicht dabei vom Straßennetz her einer Leiter.
- Die Häuser wurden alle einheitlich mit Schiefer und im gleichen Baustil errichtet: Drei oder fünfachsig und mit dem Hauseingang in der Mitte.
- Der Brand und der Wiederaufbau prägen das einheitliche Stadtbild bis heute und sollen auch zukünftig weiter erhalten werden.
Textilindustrie
Für den neueren Aufschwung der Schmallenberger Wirtschaft ist vor allem die Textilindustrie verantwortlich. Diese setzte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend durch. Bekannte Schmallenberger Textilhersteller sind dabei Franz Kayer, Sophie Stecker und die Firma FALKE, welche bis heute noch in vierter Generation familiengeführt wird.
- Die Textilindustrie florierte seit dem beginnenden 19. Jahrhundert und löst damit allmählich das Kleineisengewerbe ab.
- In Schmallenberg setzte sich die Textilindustrie ab den 1850er Jahren endgültig durch und war fortan der bestimmende Industriezweig in der Stadt.
- Zu den Begründern der Schmallenberger Textilindustrie zählten die Unternehmen Störmann & Bitter, Veltins & Wiethoff sowie die Fabrikanten Franz Kayser und Salomon Stern, aber auch Sophie Stecker.
- Zunächst setzte man vor allem auf die Wolle von einheimischen Schafen, danach wurden zunehmend Rohstoffe aus Australien und Neuseeland importiert.
- Einen hohen Absatz generierten die Schmallenberger Produkte bei den Arbeitern im Ruhrgebiet. Dazu waren diese einfach zu produzieren, was zu einem enormen Arbeiterzuwachs unter der ungelernten Landbevölkerung sorgte.
- Das Unternehmen FALKE wurde 1895 durch den Schmallenberger Franz Falke-Rohen gegründet. Heute ist das Unternehmen in der ganzen Welt tätig und wird in vierter Generation familiengeführt.
Jüdisches Leben
Die Ursprünge des jüdischen Lebens in Schmallenberg reichen in das 17. Jahrhundert zurück. Bis 1938 existierte eine Synagoge mit dazugehöriger jüdischer Gemeinde, welche durch die Untaten des Holocaust aus Schmallenberg vertrieben und umgebracht wurde.
- Im Jahr 1685 findet sich die erste schriftliche Erwähnung einer jüdischen Familie in Schmallenberg.
- Die Synagoge wurde 1857 auf dem Grundstück des Schmallenberger Juden Isaak Bamberger erbaut.
- Im Zuge der der Reichspogromnacht am 10. November 1938 wurde die Synagoge zerstört.
- Bis 1943 wurden alle in Schmallenberg lebenden Juden deportiert und umgebracht. Nur ein paar von ihnen überlebten den Holocaust.
- 1988 erfolge die Einweihung einer Gedenktafel für die Opfer des Holocaust, an der Stelle der ehemaligen Synagoge.
- Im Jahr 2012 wurden 36 Stolpersteine verlegt, welche bis heute an die Schicksale der Schmallenberger Juden erinnern.
Kommunale Neugliederung
1975 wurde aus den beiden Ämtern Schmallenberg und Fredeburg eine Stadt geschaffen. Mit insgesamt 84 Ortsteilen und einer Fläche von über 300 Quadratkilometern ist Schmallenberg die flächenmäßig größte kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen.
- Durch die kommunale Neugliederung entstand zum 1. Januar 1975 die Stadt Schmallenberg. Mit 24.735 Einwohner und 302,6 Quadratkilometern war sie damals wie heute die flächenmäßig größte Kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen.
- Dazu wurden die 12 Gemeinden mit insgesamt 84 Ortschaften zu einer Stadt zusammengelegt.
- Der Sitz der Stadtverwaltung ist seitdem in Schmallenberg angesiedelt.